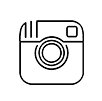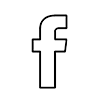Stefan Lawrence (Hg.): Digital Wellness, Health and Fitness Influencers
Erschienen bei Routledge, London/New York, 2022, 232 Seiten, ISBN 978-1000772142.
Sind wir eigentlich Wellnessgurus? – dieser Satz fiel einmal mitten in eine unserer hitzigeren Vereinsdebatten, halb als Vorwurf, halb als schmerzlich ehrliche Selbstdiagnose. Er blieb mir hängen. Nicht, weil er mich beunruhigte, sondern weil er eine eigentümliche Neugier freilegte: Wie viel von dieser digitalen Wellness-Welt steckt eigentlich schon in uns?
Es war absehbar, dass ich an mehreren langen Nachmittagen mit Fachliteratur nicht vorbeikommen würde. Und so stieß ich auf Stefan Lawrence. Schon der erste Blick auf den stattlichen Umfang seines Sammelbandes machte mir klar, was bevorstand: Es gibt Bücher, die liest man mit leichter Hand, wie einen Espresso am Morgen. Und es gibt Bücher, durch die man sich hindurcharbeitet, ausgestattet mit einem randvoll beschriebenen Notizbuch, in dem die Exzerpte eher nach Feldforschung klingen als nach Lesefreude. Bücher, die man liest, um später in Diskussionen schwerer zu wiegen – mit Argumenten, Begriffen, Vokabular. Genau in diese zweite Kategorie gehört Stefan Lawrences Digital Wellness, Health and Fitness Influencers: Critical Perspectives on Digital Guru Media.
Also gut: Worum geht es hier eigentlich? Der Band versammelt zwölf Beiträge internationaler Forscher:innen und macht aus dem Begriff Digital Guru Media ein präzises Instrument, mit dem sich die grelle Welt der Fitness-, Ernährungs- und Selfcare-Influencer:innen sezierend betrachten lässt. Kein Alarmismus, kein Applaus – vielmehr eine wohltuend nüchterne, dabei politisch wache Analyse, die die Versprechen digitaler Selbstoptimierung in ihre Bestandteile zerlegt.
Die Theorie steht nicht im Weg, sie öffnet Räume. Zwischen kulturwissenschaftlicher Tiefenbohrung und konkreten Fallstudien entstehen Linien durch ein vermintes Gelände: Tara Brabazon liest die Les-Mills-Routinen als Symptom eines „Panik-Kapitalismus“ nach der Finanzkrise; Btihaj Ajana spannt die Quantified-Self-Bewegung zwischen Selbstermächtigung und technologischem Ausgeliefertsein auf; andere Kapitel durchleuchten Kayla Itsines’ Fitnessimperium, die Clean-Eating-Bewegung oder YouTube-Vlogs – stets mit Blick auf die Inszenierung von Authentizität, Gefühlen und moralischer Überlegenheit.
Was überzeugt, ist die Weite des Blicks. Psychoanalyse trifft auf feministische Sportsoziologie, digitale Geografie auf Medienethik. Der Wellness-Hype wird nicht monokausal erklärt, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Verwerfungen lesbar: Neoliberalismus, Informationskapitalismus, das unstillbare Verlangen nach „Echtheit“ im digitalen Raum. Besonders stark ist der Band dort, wo Gefühle selbst – Empowerment, Motivation, Stärke – als Währung der Communities sichtbar werden und die Heilsversprechen der Gurus an alte Muster von Status, Selbstdisziplin und Konsum andocken.
Und doch stolpert man gelegentlich über die Höhe der Hürden. Manche Beiträge sind sehr akademisch, mit schwerem Theoriegeschirr (Žižek hier, Evolutionspsychologie dort) und entsprechend wenig alltagsnah. Die Stimmen der „gewöhnlichen Nutzer:innen“ bleiben leise; die Analyse verweilt häufig auf der Metaebene. Wer einen schnellen Praxisleitfaden für den Umgang mit Influencer-Botschaften sucht, wird hier nicht bedient – wer jedoch ein begriffliches Werkzeugset will, wird reich ausgestattet.
Bleibt die eigentliche Pointe. Dieses Buch ist kein Wellness-Produkt über Wellness – es ist eine Einladung zur Debatte. Hervorragend recherchiert, klug kuratiert und mit dem Mut, populäre Gewissheiten zu befragen. Für unsere nächste Vereinssitzung heißt das: Wir können weiterhin darüber streiten, ob wir Wellnessgurus sind. Aber wir tun es künftig mit besseren Begriffen – und vermutlich mit mehr Gelassenheit.